Die neuen Schutzhütten Rumäniens
Zwoa Brettl, a gführiger Schnee, juchhe
dös is halt mei höchste Idee
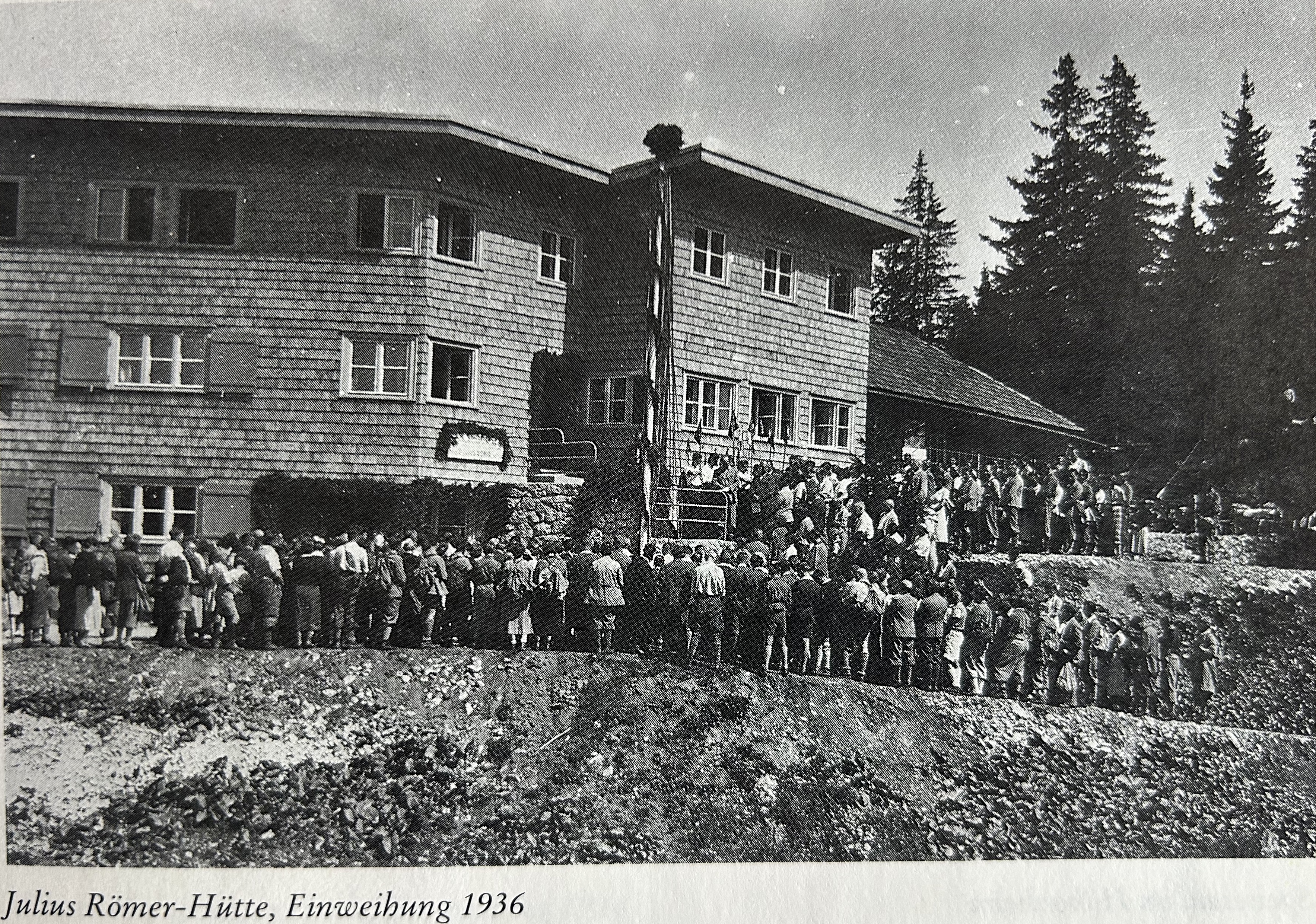
Die Bestimmung des Begriffs „Berghütte“ in Rumänien erfordert heutzutage einen gewissen Aufwand. Dieser wird jedoch dadurch ausgeglichen, dass sich dadurch zahlreiche Möglichkeiten zur Lösung wirtschaftlicher, sozialer, bildungsbezogener, mitunter auch kultureller und nicht zuletzt ökologischer Probleme eröffnen.
Ohne auf diese Problematik ins Detail einzugehen – dies würde eine umfangreichere Studie erfordern als der vorliegende Leitfaden (oder vielleicht sogar mehr) – befasst sich die vorliegende Studie mit diesen Problemen in dem Bemühen, die aktuellen Möglichkeiten für den Bau von Berghütten herauszufinden. Der Faden, der verfolgt wird, sucht für die Möglichkeiten, einerseits die Integration der Konstruktionen in die Bergwelt und andererseits eine geringere Auswirkung auf diese zu gewährleisten (vor allem durch die Reduzierung der Kohlendioxidemissionen). Diese sind die Hauptziele des Projekts.
Um diese Ziele zu erreichen, haben wir den Leitfaden in zwei Kapitel unterteilt.
Im ersten Kapitel werden die Probleme, mit denen der Hüttenbau in den rumänischen Karpaten derzeit konfrontiert ist, isoliert, dargestellt und bewertet.
Die Untersuchung wird durch eine pragmatische und theoretische Analyse des aktuellen Stands der Dinge eingeleitet. Die beiden Ebenen werden in ihrer Wechselwirkung und nicht getrennt voneinander behandelt. Aus ihrem Zusammenspiel ergeben sich die Kriterien und Mittel zur Bewertung der Probleme. Aus ihren Schlussfolgerungen werden im zweiten Teil Argumente für die Bedingungen der Umsetzung der in den Dokumentationsreisen ermittelten Lösungen entwickelt. Diese Untersuchung ist notwendig, um eine Kontinuität zwischen der Besonderheiten in den rumänischen Karpaten und den dokumentierten europäischen Lösungen zu gewährleisten, wenn eine Hütte gebaut oder saniert wird, oder wenn eine andere Analyse verfeinert wird, bei der Berghütten eine wesentliche Rolle spielen, oder für jeden anderen Zweck, bei dem es sich als nützlich erweist — mindestens zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Leitfadens.
Darüber hinaus ist diese Studie sehr nützlich, um die besonderen Merkmale der Karpaten-Berghütten im Vergleich zu denen anderer Gebirgszüge herauszuarbeiten. Im zweiten Teil werden Bereiche behandelt, in denen spezifische Ansätze für die rumänischen Karpaten entwickelt werden können.
Die Analyse im ersten Teil des Leitfadens ist um das Dreieck Mensch — Berg — Hütte herum aufgebaut. Die Abstände zwischen diesen Eckpunkte des Dreiecks und die Beziehungen zwischen ihnen geben uns ein Maß für die Probleme des Bergwanderung. In der Tat ist dieses Dreieck ein „Spiegelbild“ des Dreiecks, das von den drei „Säulen“ der Nachhaltigkeit gebildet wird — der sozialen (Mensch), der ökologischen (Berg) und der wirtschaftlichen (Hütte).
Das Kapitel fängt mit einer Untersuchung der Beziehung zwischen dem Menschen und den Bergen an. Die Lage des Bergwanderung in den rumänischen Karpaten wird sowohl in Bezug auf seine anderthalb Jahrhunderte umspannende Geschichte als auch in Bezug auf die aktuelle Konjunktur in vielen europäischen Ländern, in denen die Berge eine wichtige Ressource darstellen, bewertet.
Auf den drei Ebenen, die durch die Dimensionen der Nachhaltigkeit bestimmt werden, haben wir in unserem Land eine Reihe von Probleme erkannt, die verschiedene Quellen haben, von denen einige sogar voneinander abhängig sind. Die Existenz dieser Probleme, die mangelnde Sorge auf staatlicher Ebene, sie zu lösen, und die mangelnde Sorge, ihre Auswirkungen zu begrenzen, haben dazu geführt, dass sie sich in einem Ausmaß verschärft haben, das schwer abzuschätzen ist. Die Probleme, welche die Nachhaltigkeit gefährden, breiten sich nach dem Domino-Prinzip auf das gesamte Leben der Gesellschaft aus. In diesem Leitfaden beschränken wir uns auf die Identifizierung und Beschreibung jener Probleme, die in direktem Zusammenhang mit der von uns behandelten Bauweise stehen. Dabei legen wir besonderen Fokus auf jene, die erheblichen Einfluss auf die natürliche Umwelt haben, sowohl durch gewaltsame Handlungen als auch durch die Zunahme von Emissionen aller Art, sowohl durch die direkte Fehlfunktion der Gebäude der Hütten als auch durch die Entstehung von sozialen, geographischen oder städtischen Störungen. Diese Störungen führen zur Entwicklung umweltschädlicher Unterkunftsstrukturen anstelle von Schutzhütten, zur übermäßigen Erleichterung der Autozufahrt oder zu anderen Schwierigkeiten, von denen einige den Rahmen dieser Studie sprengen würden.
Am Ende dieser ersten Untersuchung werden mögliche Richtungen vorgeschlagen, um sowohl die Situation zu verbessern als auch eine Annäherung an den europäischen Stand der Dinge vorzunehmen.
Die zweite Untersuchung konzentriert sich auf die Beziehung zwischen Berg und Hütte. Die Achse dieser Untersuchung, wird immer wieder auch durch die Struktur des Konzepts der Nachhaltigkeit bestimmt, nämlich die Erhaltung und Pflege von Ressourcen, die zur Erreichung der angenommenen Ziele nicht unbedingt notwendig sind. Auch hier finden wir die drei Säulen der Nachhaltigkeit wieder, diesmal als drei Teilräume, in denen Probleme identifiziert und mögliche Lösungen vorgeschlagen werden.
Mit Hilfe von präzisen Analysen in diesem Bereich, die vom Schweizer Alpen-Club (SAC/CAS) im Internet zur Verfügung gestellt und an die (katastrophale) Lage in Rumänien angepasst wurden, haben wir die Probleme identifiziert, die wir lösen müssen – sowohl die direkten als auch die indirekten.
Die erste Gruppe von Problemen betrifft das Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein von Hütten und die Art und Weise, wie man sie in Betrieb nehmen könnte sowie zu einen Standard der Interaktion mit der Umwelt, der mit dem allgemeinen europäischen Standard vereinbar wäre.
Die indirekten Probleme, die sich aus der derzeitigen Situation unserer Berghütten ergeben, sind ihre Beziehungen zum sozialen, wirtschaftlichen und natürlichen Umfeld. In den meisten Fällen befinden sich diese Beziehungen heute in einem kritischen Zustand. Wie diese Zustände verbessert und in Zukunft vermieden werden können, wird ebenfalls auf den folgenden Seiten skizziert. Diese Art und Weise zu definieren ist jedoch eine Frage der Erfahrung, der Anwendung und kann erst nach mehreren Jahren des Aufbaus auf den hier skizzierten Grundsätzen erfolgen. Es gehört zu einer späteren Ausgabe dieses Leitfadens dargelegt und beschrieben werden.
Das Dreieck schließt sich mit einer Analyse der Probleme der Berghütte, natürlich in Bezug auf den Menschen, für den sie gebaut wird.
Hier wird die Berghütte in einer theoretischen (vielleicht sogar idealisierten) Weise definiert. Ihre Definition als architektonisches Programm beruht auf einer Tradition, die in den Alpen zwei Jahrhunderte und in den Karpaten mehr als ein Jahrhundert zurückreicht.
Die Karpatenhütten, wie sie vor einem Jahrhundert definiert wurden, gibt es heute nicht mehr. Ein großer Teil von ihnen ist um die Jahrhundertwende einfach verschwunden, weil der rumänische Staat es versäumt hat, eine kohärente Politik diesbezüglich zu entwickeln. Ein anderer Teil hat zwar der inkohärenten Politik des rumänischen Staates überlebt, hat aber durch die großen Anstrengungen, die die Besitzer gerade für dieses Überleben unternommen haben, seine bekannte Form verloren.
Diese beiden Aspekte veranlassten uns, nach Modellen außerhalb Rumänien zu suchen und zu identifizieren. Historische Daten reichten nicht aus. Sie sind Zeugnisse und nicht die unmittelbare Realität. Diese Realität zeigt uns die Problemen, denen wir in unserem Modell begegnen werden. Da diese Probleme mit der Realität von heute zusammenhängen und nicht mit der des Augenblicks, in dem wir Zeugnis ablegen, ist der Wert von lebendigen Modellen unbestreitbar.
Daher wird der Rahmen der Funktionen, die eine Karpatenhütte erfüllen muss, nach der Untersuchung einer Reihe von Hütten in den Alpen, den Pyrenäen und den skandinavischen Alpen definiert. Die Schlussfolgerungen dieser Studie sind im ersten Teil des Projekts, zu dem die vorliegende Studie gehört, enthalten und werden in diesem Unterkapitel wiederholt.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Betrieb der Hütte mit einem Minimum an Emissionen von Kohlendioxid, Schadstoffen oder anderen umweltschädlichen Stoffen. Dabei wurde auf jegliche „Rationalisierung“ des Komforts verzichtet und schon gar nicht auf die Sicherheit im Gebirge, die die Hütte auf jeden Fall gewährleisten muss.
Im vorletzten Teil des Unterkapitels wird eine mögliche Typologie von Berghütten in unserem Land vorgestellt, um die Bedürfnisse der Natur, der Erholung und des Sports für einen möglichst großen Teil der Bevölkerung des Landes zu decken und möglichst vielen Menschen den Zugang zu den Bergen zu erleichtern, und zwar unter weitaus besseren Sicherheitsbedingungen als den heutigen. Auch wenn das gesamte Kapitel das hier genannte Ziel verfolgt, hielten wir es auch für notwendig, die Probleme darzustellen, die die Entwicklung der Berghütten in unserem Land — als es sie gab — mit sich brachte oder bringt. Sie in diesem Zusammenhang und — was noch wichtiger ist — als Vorspann zu den wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen des Hüttenbaus darzustellen, macht die Darstellung zielführend.
Der letzte Teil dieses ersten Kapitels, der theoretisch sein und die Begriffe definieren soll, um die es geht, wird von der Darstellung der rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Probleme überlagert, die mit der Genehmigung und Zulassung des Baus einer neuen Hütte oder der Sanierung einer bestehenden Hütte verbunden wären.
Dies wirft eines der schwerwiegenden Probleme auf, die die Hütten derzeit darstellen — die Rechtmäßigkeit des Baus, die Rechtmäßigkeit der Eingriffe. Diese Probleme öffnen die Tür zu Ungereimtheiten und Improvisationen in der Entwicklungsstrategie und, was noch schwerwiegender ist, zu massiven Hindernissen aufgrund des fehlenden definierten Zugangs zu spezifischen Finanzmitteln wegen der oft verwirrenden Grundstücks- und Verwaltungssituation.
